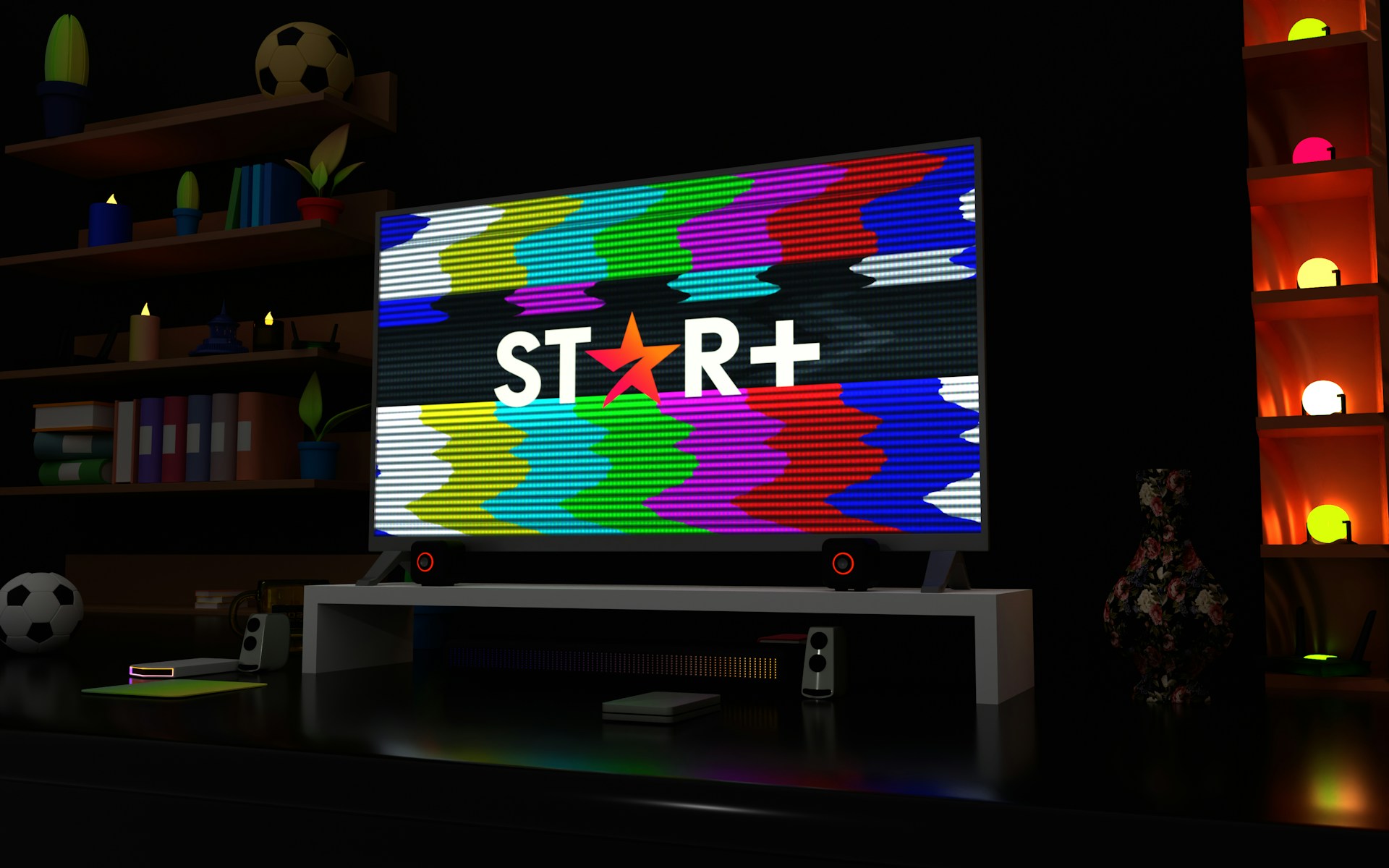Es gibt kaum eine Krimiserie, die Eleganz, Melancholie und Intellekt so kunstvoll verwebt wie „Der junge Inspektor Morse“. Aktuell flimmert in Deutschland das vorerst letzte Kapitel dieser außergewöhnlichen Produktion über die Bildschirme. Im Zentrum steht ein Mann, der seinen Vornamen hütet wie ein Staatsgeheimnis. Endeavour, so lautet er im englischen Original, bedeutet übersetzt „Bemühung“ oder „Anstrengung“. Wer möchte schon täglich daran erinnert werden, dass das Dasein eine permanente, am Ende vermutlich vergebliche Anstrengung ist? Shaun Evans verkörpert diesen Endeavour Morse mit einer fast schmerzhaften Intensität. Er ist ein außergewöhnlich attraktiver Mann mit geschmeidigen Bewegungen, dessen große blaue Augen oft in mühsam unterdrückten Tränen schwimmen – sei es aus jähem Erschrecken oder aus Trauer über die Abgründe, die er erblicken muss. Diese allgegenwärtige Traurigkeit, gepaart mit einer ästhetischen Schönheit, macht die Serie zu einem der stilvollsten Fernseherlebnisse der letzten Jahre.
Schatten über Oxford
Als Prequel zu der legendären Serie „Inspector Morse“ (1987–2000), basierend auf den Romanen des verstorbenen Colin Dexter, übertrifft „Endeavour“ das Original an Dunkelheit und visueller Raffinesse. Das Oxford der Sechziger- und Siebzigerjahre dient als Kulisse, die zugleich erhaben und erstarrt wirkt. Akribisch registriert die Serie soziale Erschütterungen jenes Jahrzehnts: Arbeiterunruhen, den Terror der „Angry Brigade“ und den tief verwurzelten Rassismus gegenüber Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien. Shaun Evans legt seinen Charakter meisterhaft zwischen intellektueller Arroganz und privater Unsicherheit an. Unterstützt wird er von einem brillanten Ensemble, allen voran Roger Allam als Detective Inspector Fred Thursday. Dieser grimmige Haudegen mit der Vergangenheit eines Untergrundkämpfers wird zum moralischen Anker für den jungen Morse. Auch Chief Superintendent Bright, gespielt von Anton Lesser, wächst einem mit seiner Mischung aus Strenge und Gerechtigkeitssinn ans Herz; sein ständiges „Und weiter!“ avancierte längst zum Leitmotiv. Untermalt wird dies alles vom opulenten, fast pathetischen Soundtrack Barrington Pheloungs, der im Hauptthema subtil den Namen „M-O-R-S-E“ codiert.
Ein gewagtes Erbe
Während „Der junge Inspektor Morse“ zeigt, wie man einen klassischen Stoff vertieft und bereichert, demonstriert eine neue Produktion das genaue Gegenteil. Wer sich anmaßt, eine Miniserie über Wolfgang Amadeus Mozart zu drehen – eines der definierenden Genies der westlichen Zivilisation – und dabei auf Peter Shaffers geniales Theaterstück und den nahezu perfekten Film von 1984 zurückgreift, sollte sicherstellen, dass er dem Stoff neue Facetten abgewinnen kann. Andernfalls läuft man Gefahr, sich lächerlich zu machen. Genau dieses Schicksal ereilt die neue sechsteilige Dramaserie „Amadeus“. Die Macher Joe Barton und Julian Farino haben Teile von Shaffers Werk übernommen, sie jedoch in eine banale, luftleere Form gepresst. Themen wie die korrumpierende Kraft des Neides oder das Mysterium göttlichen Talents verkommen hier zu blassen Abziehbildern ihrer selbst.
Banalität statt Brillanz
Die erzählerische Rahmenhandlung beginnt bereits mit einer entscheidenden Senkung der Fallhöhe: Der gealterte Antonio Salieri, gespielt von Paul Bettany, beichtet nicht mehr einem Priester, wodurch er sein Seelenheil riskieren würde, sondern lediglich Mozarts Witwe Constanze. Er erleichtert nur sein Gewissen. Als wir Mozart schließlich begegnen – verkörpert von Will Sharpe –, fällt er betrunken aus einer Kutsche und erbricht sich vor den Augen seiner zukünftigen Vermieterin. Zwar etabliert sich Mozart am Wiener Hof und treibt Salieri in die Verzweiflung, doch fehlt der Darstellung jegliche Tiefe. Salieris Tragödie, als einziger das wahre Genie Mozarts zu erkennen, verpufft in einer Inszenierung, die das Unaussprechliche banalisiert.
Besonders schmerzhaft wird dies im direkten Vergleich zur berühmten Manuskript-Szene des Films. Wo im Original Salieri beim Betrachten der Notenblätter die göttliche Struktur der Musik wortgewaltig beschrieb („Verschiebe eine Note, und es gäbe eine Minderung“), schwenkt hier die Kamera lediglich lieblos über saubere Notenblätter im Gegensatz zu Salieris durchgestrichenen Entwürfen. Will Sharpes Darstellung erinnert dabei fatal an die Figur Moss aus der Sitcom „The IT Crowd“ – ein Milchbubi mit Alkoholproblem. Dass Salieri in diesem „widerlichen Geschöpf“ Gottes Stimme hören soll, wirkt in dieser Version schlichtweg unglaubwürdig. So bleibt am Ende nur die Erkenntnis, dass nicht jede Adaption das Zeug zum Klassiker hat.